Bei Rosie
- 22. Sept. 2022
- 3 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 14. Dez. 2022
In Rosies Bar im harburger Hafengebiet steht ein Obstautomat. Er spuckt aber nur
leuchtendes, virtuelles Obst aus. Manchmal bekommt man drei Orangen, dann rumpelt es,
klirrt und der Gewinn wird ausgeschüttet. Leider ist es bisher noch nie passiert. Aber das hält
die Omi nicht davon ab, immer wieder reinzugehen, reinzustecken, Knöpfe zu drücken und
zu hoffen. Draußen im Garten rund um die Rosi Bar sind Tische und Stühle aus Plastik und
ein Strandkorb angeordnet. An einem Tisch sitzt eine Familie, Mutter, Vater Kind mit Omi,
Opa und Onkel. Das Kind ist ungefähr fünf bis sieben Jahre alt. Die Gesichter der Eltern
geben ihr Alter nicht mehr Preis, der Alkohol hält das Geheimnis unter Verschluss.
Wahrscheinlich sind sie gerade 30. Der Tisch ist gedeckt mit Alkohol jeder Art, die Kleine (so
wird sie genannt) hat eine gelbe Brause, es steht ein Kinderteller mit Pommes und
Currywurst auf dem Tisch.
Die Kartoffelfinger bewegen sich, zeigen auf die traurigen versumpften Augen der Eltern. Sie
zeigen auf und an, als könnten sie sprechen: hört auf, hört auf zu saufen, ihr habt doch ein
Mädchen, die läuft durch die Abrissgegend, es ist hier nicht sicher. Mutti, eye du lallst ja
schon.
Das Mädchen lässt die Kartoffelfinger liegen, isst nichts. Sie springt um den Tisch mit all den
Familienflaschen. In der Bargegend liegt das Land brach. Die meisten Fabriken wurden
bereits abgerissen. Auf dem Nachbargelände wütet der Bagger, schaukelt die Abrissbirne,
hämmert der Kran. Es ist kein Spielplatz. Sie läuft weg, wird gerufen, kommt nicht wieder,
das Rufen wird rauer, kommt wieder. Sie springt in Rosis Garten umher. Die Currywurst steht
auf dem Tisch und biegt sich in alle Richtungen, wie ein Mikrophon. Die ganze Familie lallt
reihum hinein. Das Mädchen schafft es einfach nicht, etwas zu essen. Die anderen trinken ja
auch nur.
Malstifte und Papier werden gebracht. Die Kellnerin ist von besonderer Schönheit. Ihre
Stimmbänder klingen wie singende Sägen, an denen ein Kontrabassbogen langschabt. Ihre
Stimme klingt, als kämen beim Sprechen kleine Rauchwölkchen aus Mund und Ohren. Sie ist
eine Nikotinschönheit. Sie sammelt die leeren Gläser und stellt keine neuen hin. Omi geht
wieder zum Obstautomat, Opa klappt die Börse auf und bezahlt den blauen Betrag auf dem
grauen Papier.
Das Mädchen ordnet die Pommes an, sie zeigen in alle Richtungen. Sie legt die Wurst zurück
an ihren Platz, sie guckt dabei ihren Onkel an. Er sieht mit seinen Glanzpupillen nach unten,
er ist ein lieber Kerl. Solche Gedanken tun ja keinem weh. Die Familie bricht auf, die
Fettfinger werden am Kleid abgestreift, fünf Streifen auf jeder Seite, sie geben dem
Mädchenkleid ein anderes Muster. Es wird zum Entsetzen der Kellnerin noch Auto gefahren.
Es wird krächzend angemahnt, die Mutter lallt sie solle die Schnauze halten, der Opa ist ein
Holzstamm, den hat noch keiner umgesägt. Die Familie verschwindet im Auto. Es fährt
ziemlich gerade durch das gerodete Gebiet.
Drei Wochen später laufen die Eltern um 11:15 Uhr über den Harburger Rathausplatz. Sie
setzen sich mit einem Morgenbier auf die Bank. Vier traurige Augen schauen auf das
Straßenpflaster. Immerhin sind sie zusammen traurig. Sie rauchen und schweigen. Er trägt
eine gelbe Steppjacke, sie trägt eine gelbe Hose, sie mögen sich wirklich gerne. Ihr Mädchen
ist in der Schule, sie kümmern sich so gut um sie, wie sie es eben können. Sie kümmern sich
so gut um sie, dass es gerade reicht, bevor jemand kommt und anmahnt. Es reicht, es geht
und es ist auch nicht jeden Tag gleich schwer. Die Omi ist da, die spielt zwar gerne, aber
dafür trinkt sie wie ein Kätzchen. Die Omi ist die nüchterne Stütze. Ohne sie ginge es nicht,
ohne sie würde der Staat sagen: Stopp. Und was ist schon gegen ein paar klingelnde Orangen oder Bananen zu sagen?





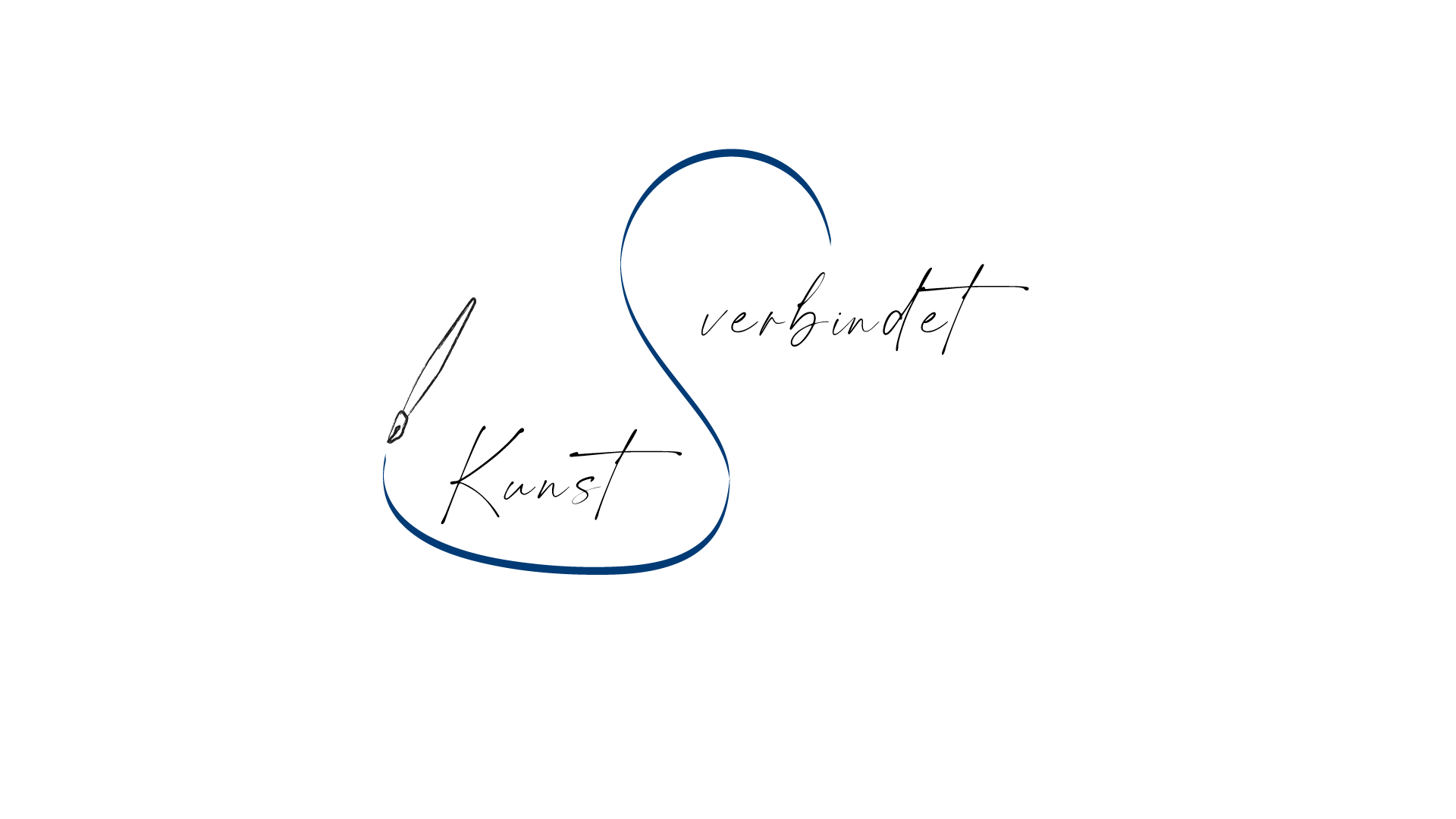
Comentarios