die Ironie
- katelijne7

- 6. Aug. 2023
- 4 Min. Lesezeit
Da ist ein Messer in der Tasche, stellt der Sicherheitsbeamte im Flughafen alarmiert fest. Er fragt, ob er meine Jackentaschen durchsuchen darf, ich nicke und sehe aus dem Augenwinkel, wie die Ironie fragend um die Ecke guckt und lächelt. Hatte ich nicht gestern noch die Geschichte erzählt von dem Messer, das ich im Frühling vor den Augen eines kopfschüttelnden Publikums wegwerfen musste, und von dem neuen Messer, das ich bei Monsieur Daniel gekauft habe? Schon wieder habe ich nicht daran gedacht, es rechtzeitig in den Koffer zu packen.
Die Ironie tanzt jetzt ausgelassen im Kreis. In diesem Moment fällt mir ein, dass das nicht das einzige Messer ist. In der Handtasche ist noch ein größeres. Ich warte seufzend, sehe zu, wie es auf dem Bildschirm des anderen Sicherheitsbeamten erscheint.
Beide Beamten gucken sich mit großen Augen an und zeigen streng auf die Opinel-Messer.
Die seien eindeutig zu groß, absolut verboten. Ich versuche, sie zu besänftigen, die Messer müsse man aktiv öffnen, sie springen nicht automatisch auf, aber die Ansage ist eindeutig.
Das sehe ich ein, ich checke mich wieder aus und gehe den ganzen Weg zurück bis zur Gepäckaufgabe. Dort schlägt man mir schulterzückend vor, beide Messer für 70 Euro einzuchecken. Ich winke ab und laufe langsam wieder den Weg zur Sicherheitskontrolle, während meine Gedanken rasen.
Hier ist ein Geschenk für Sie, sage ich dem Weinverkäufer. Er sieht mich an, ist froh, dass jemand bei seinem Laden anhält, denn es ist noch früh am Morgen, kein Mensch will Wein kaufen jetzt. Ich staune, wie undurchdacht er sich dort positioniert hat, genau an der Stelle, wo alle Flüssigkeiten entsorgt werden müssen. Vielleicht kann man so seine Alkoholsucht loswerden, indem man teuren Wein nicht im Duty-Free-Shop, sondern hier, bei der Sicherheitskontrolle, kauft und ihn dann gleich wegkippt. Sodass es richtig wehtut.
Wer kauft hier Wein, frage ich mich, wer?
Der Mann sieht sich bewundernd die Messer an, wiegt sie in der Hand, freut sich über den Korkenzieher an der Seite des größeren Messers. Ein richtiges Winzerwerkzeug, nickt er anerkennend. Zum Reben schneiden! Und so schön, mit dem Griff aus Holz. Und gleich zwei davon. Ich nicke.
Er würde darauf aufpassen, meint er, und auf der Rückreise könne ich dann die Messer wieder abholen. Vielleicht wäre der Kollege dann da, er würde ihm einen Zettel hinlegen.
Ich schreibe Namen und Telefonnummer auf einen Bierdeckel, den ich noch in der Tasche habe (haha, Sie sind Biertrinkerin, und dann noch Kölsch, richtig scheiße!), und er wünscht mir einen guten Flug und bis nächste Woche.
Wer hier Wein kauft?
Ich, denke ich. Auf dem Rückweg werde ich wohl für 70 Euro Wein kaufen müssen.
Ich schleiche mich wieder durch den Sicherheitsbereich. Schuhe ausziehen, Drogentest, Sprengstofftest, das gesamte Sicherheitspersonal ist scharf. Und ich komme weiter, entwaffnet, ohne Sprengstoff und drogenbefreit, fertig für die Reise.
In Edinburgh hat es 15 Grad statt 35 Grad in Köln, und es regnet. Später, in den Highlands, regnet es auch, aber gleichzeitig scheint die Sonne. Die Luft ist dunkel und dann wieder hell, so geht es die ganze Woche. Regen, Sonne, ein hoher Himmel voller Wolken. Wege durch Riesenfarn, über alten Steinen, an Mäuerchen entlang, durch Schluchten und über Berge. Die Mietautos sind immer die neuesten Autos, ich erkenne sie daran, dass sie links vorne die Felge zerkratzt haben.
Mein Shop ist der meistfotografierte des Landes, behauptet Alan, der zwischen tausenden Instrumenten und Instrumententeilen steht. Hier kann man seinen Dudelsack konfigurieren lassen, falls man davon schon immer geträumt hat. Ich sehe mir die Werkstatt an, es riecht nach Holz, Metall und Leder. Alan erzählt, dass er früher Fischhändler in Irland war, dort sind ihm aber die Ohren abgefroren. Später ist er für einige Zeit nach Neuseeland ausgewandert. Er hat Meereskunde studiert und ist nach Schottland gekommen, wo er angefangen hat, alte Instrumente zu reparieren und neue zu bauen. Ich könnte beschreiben, wie so ein Dudelsack entsteht, was für eine Präzisionsarbeit das ist, aber am besten schauen Sie selbst mal, Alan Waldron freut sich auf Ihren Besuch.
Er schickt mich hinter die Friedhofsmauer, dort ist ein Restaurant, das leider im Moment keine Küche hat, weil zu wenig Personal, aber man sitzt dort schön, windgeschützt, ein bisschen so wie in einem deutschen Biergarten, ha!
Ich sehe über den Friedhof, die langen, schmalen Grabsteine zeigen in den Himmel, die Abendsonne springt hinter einer Wolke hervor und streut kühles Gold über die Landschaft.
Hello dear, sagt die Bedienung, weil ich unentschlossen an der Theke stehe und nicht weiß, was ich trinken will. Die großen Zapfhähne mit den unbekannten Bieren sind beeindruckend.
I’ll be happy to serve you any time, love.
Ich stelle mir diesen Spruch im deutschen Biergarten vor, an einem luftigen Vormittag Mitte Juli, unter einem weiten Himmel in blau und weiß.
Rosa und Hector sind die jüngsten Familienmitglieder meiner schottischen Verwandtschaft. Sie werden in der kleinen Steinkirche des alten Dorfes getauft. Sie ist schief, wie die Grabsteine drum herum. Es regnet und ein Regenbogen färbt die dunkle Luft in allen Farben.
Später bewegt sich die Taufgesellschaft am Fluss entlang. Die Feier findet im Garten des Familienhauses statt, es gibt ein großes Lagerfeuer, Whisky, Wein und Bier, eine Band. Die Männer laufen in Schottenröcken herum. Ich sitze auf der alten Steinmauer und sehe zu, wie ein Ferkel am Spieß gebraten wird.
Einer spielt Dudelsack.
Bald geht es wieder nach Köln.
Wie es wohl aussähe, wenn einer dieser Wikinger mitkommen würde? Im Schottenrock, mit Messer im Strumpf und Dudelsack? Ich würde mich mit ihm an den Rhein setzen, Bier bestellen und mich wundern, wie das kleine Glas in der Hand verschwindet.
Am Rückreisetag parke ich das Auto mit der zerkratzten Felge am Flughafen, fülle die Formulare aus, gehe durch die Kontrolle, fliege durch eine Zeitzone, kaufe Wein in Köln, bekomme meine Messer wieder.
Die Luft ist heiß, stickig, der Verkehr schnell und hektisch. Vielleicht sollte ich am Rhein entlang laufen, mich in einen Biergarten setzen und hey love zum Kellner sagen.
Zuhause setze ich mich auf die Terrasse, schreibe einen Brief an die zehn Wochen alten Zwillinge Rosa und Hector, wie schön das Familienfest im Garten zwischen den alten Mauern war, wie wertvoll.
Ich öffne eine Weinflasche, frage mich, wieso Südafrika, als würden wir noch nicht genug hin und her fliegen. Können wir nicht einfach deutschen Wein kaufen, Dornfelder aus der Hochheimer Hölle zum Beispiel? Oder einfach ein Kölsch trinken?
Oh nee, denke ich, Kölsch muss jetzt nicht sein. Auch die sanftmütige Ironie hat ihre Grenzen.





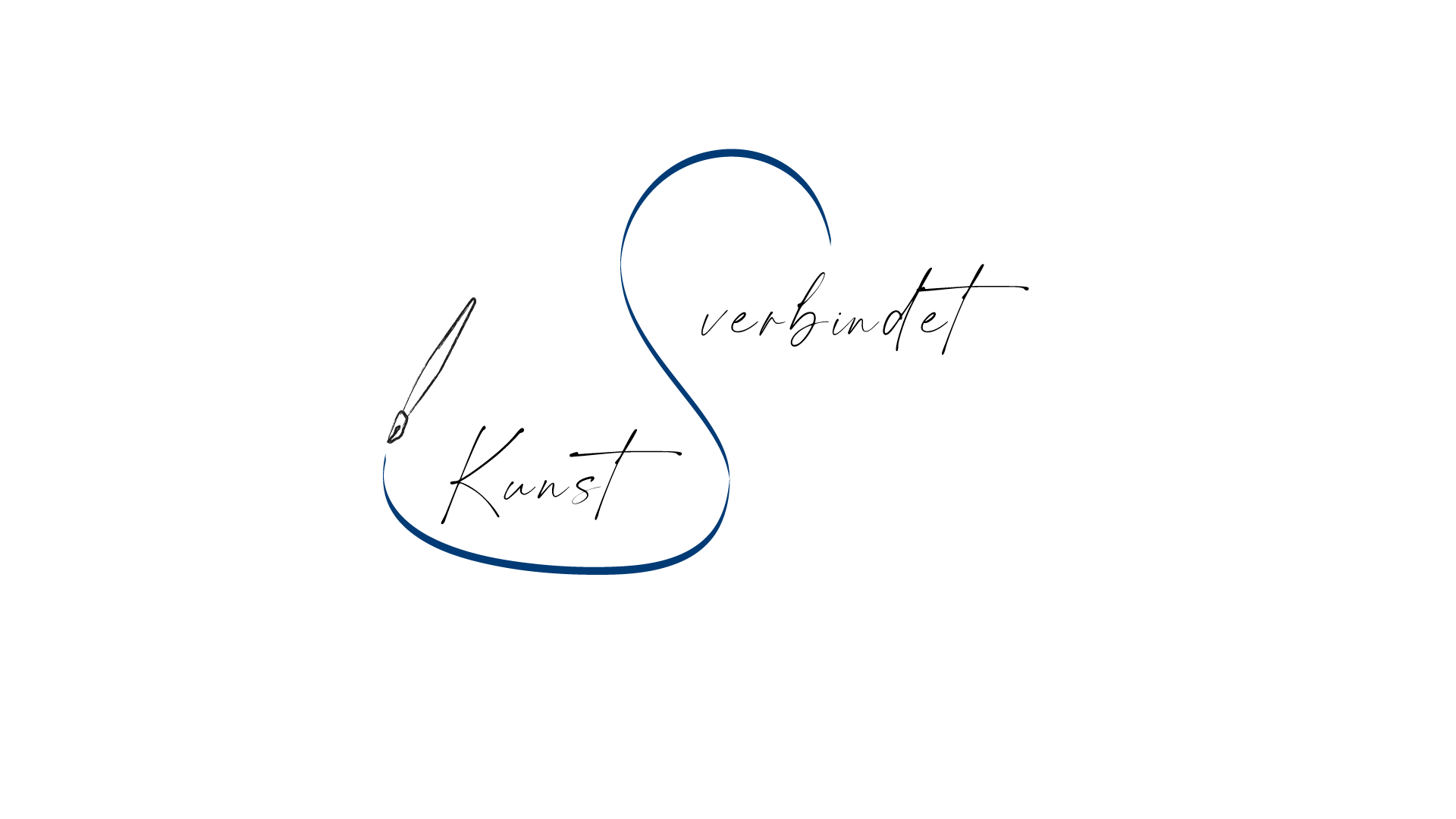
Comments