Mehr Leben
- katelijne7

- 21. Sept. 2024
- 4 Min. Lesezeit
Ob ich noch etwas für sie einkaufen könne? Es ist kalt und regnet in Strömen, ich besuche sie, es geht ihr nicht gut. Der Krebs.
Nein, sagt sie, sie muss selbst losgehen. Ich sehe sie an, eine kleine achtzigjährige Dame, wie sie dort unter ihrer Decke zwischen den Sofakissen fast verschwindet und kaum reden kann. Sie holt ein Taschentuch hervor und schnieft sich die Nase. Sie steckt es wieder zwischen die Kissen, sieht mich an.
Ach so, gibt sie nach, ich habe eine Liste. Mühsam steht sie trotz meines Protestes auf und geht wankend in die Küche, wobei sie sich an der Wand entlangtastet. Ich folge ihr, nehme die Liste, die auf der Anrichte liegt. Ich gehe erst, als sie wieder unter der Decke liegt.
Klopapier, Küchenrolle, Taschentücher, Kosmetiktücher. Schokolade.
Als ich mich eine halbe Stunde später mit den Einkäufen wieder ins Haus lasse – ich habe einen Schlüssel – kommt sie mühsam hoch und will die Sachen einräumen. Ich würde mich allein nicht zurechtfinden, behauptet sie. Im Vorratsraum unter der Treppe ist ein großer Stapel Klopapier, ich lege das neue darauf, auch die Küchenrolle reicht noch für eine ganze Armee, der Raum ist so voll, dass kaum noch etwas hineinpasst.
Es riecht nach synthetischer Meeresbrise, mir wird schlecht davon. Der Geruch ist in den Klamotten, auf den Teppichen, den Vorhängen. Ich nehme mir vor, die Sprühflaschen, die sich in jedem Zimmer hinter den Vorhängen befinden, sofort verschwinden zu lassen, sobald sie… ja, wann eigentlich? Worauf will ich warten?
Es ist klar, dass sie in kürzerer Zeit sterben wird, Bauchspeicheldrüsenkrebs ist so eine Sache.
Das ist kein Leben, schimpft sie, als sie ihre erste Chemotherapie bekommen hat. Es ist so richtig scheiße, sagt sie nach der dritten Sitzung und bricht die Therapie ab. So ist ein Leben in Würde nicht möglich. Ohne Chemo ist alles viel schneller vorbei, warnt die Ärztin. Ohne Chemo, drei Monate. Das hört man immer wieder. Mit Chemo, etwas länger, aber beschissen, keine Heilung.
Was hätten Sie denn gerne, klopft die Onkologin die Möglichkeiten ab, Lebensqualität oder Lebensdauer? Ich bin auf jeden Fall für Sie da, auch wenn Sie sich gegen eine Therapie entscheiden.
Sie wählt Qualität, freut sich auf ihr Zuhause, liegt die meiste Zeit auf dem Bett, isst kaum noch etwas. Ich rufe den Rettungsdienst an einem Samstagmorgen, wenn wir Tee trinken und sie im Flur fast umkippt, übel vor Schmerzen.
Bevor sie stirbt, liegt sie noch sechs Wochen im Krankenhaus, in einem großen, hellen Palliativzimmer. Ich besuche sie ein- oder zweimal am Tag. Sie ist manchmal gut gelaunt, dann gibt sie viel Trinkgeld, manchmal richtig mies, dann schimpft sie über das Pflegepersonal, das kaum richtiges Deutsch spreche. Es hängt von den Infusionen ab. An guten Tagen versucht sie, anhand von ihrem Kreuzworträtsel das Personal zu unterrichten. Man müsse sich schon die Zeit nehmen, wenn man eine Sprache lernen will, sonst wird das nichts, warnt sie. Aber keiner hat hier Zeit.
Das Essen rührt sie kaum an, sie beißt in einen Zwieback, trinkt Kamillentee mit Honig.
Ich bringe alle Lebensmittel aus ihrem Haus zur Tafel. Den ganzen Vorrat Kaffee, Sekt, Dosensuppen, Nudeln. Ich leere den Kühlschrank, schalte ihn ab. Je länger sie im Krankenhaus liegt, umso mehr Dinge entsorge ich aus dem Haus. Die Trockengestecke, Vasen, Tücher, Kissen, Lufterfrischer. Die Fenster öffne ich weit. Der Sommer soll hereinkommen, das Licht, die Wärme. Ich bringe ihr neue Kleidung, wasche die alte.
Ich habe das Gefühl, dass ich immer, wenn etwas in den Container verschwindet, einen Teil von ihr ausradiere. Ich wühle mich durch achtzig Jahre Leben und bringe es durcheinander. Hat das einen Einfluss auf ihr Schicksal? Je mehr ich entsorge, umso weniger bleibt von ihr als Person? Darf ich das? Ich fühle mich ein bisschen schuldig.
Es ist Juli, dreißig Grad, ich spaziere unter den hohen Bäumen durch den schattenreichen Park. Gehe die Treppen hoch, in das Krankenhaus hinein, den langen Flur entlang, ich grüße die Pfleger, kenne sie schon. Ihr Zimmer ist sehr warm. Ist meine Heizung noch an? Erkundigt sie sich, das Haus soll ja nicht auskühlen. Sie arbeitet prima, lüge ich. Erleichtert lässt sie sich in den Kissen fallen.
Eines Morgens hüpft sie aus dem Bett und umarmt mich. Sie sei so froh, dass ich da bin, sie wäre sonst total aufgeschmissen. Als sie sich auf meinen Schoß setzt, denke ich, das war heute ein starkes Antidepressivum. Ich bringe sie wieder ins Bett. Sie lächelt selig.
Was wohl passiert, wenn sie doch noch kurz nach Hause will, um Abschied zu nehmen? Die Teetassen stehen noch auf dem Tisch, aber es gibt nichts mehr zu essen im Haus. Die Schubladen sind leer. Das Haus hat jetzt leere Ecken und freie Wände, es kommt Licht und Luft hinein. Sie wäre erleichtert! Versuche ich mich zu beruhigen. Es wäre wie ein neues Haus, frisch und klar. Entrümpelt.
Aber sie kommt nicht mehr nach Hause.
An ihrem letzten Tag, einem Donnerstag, bin ich morgens da, es ist warmes und schönes Sommerwetter. Sie hat starke Schmerzen, ich hole die Ärztin, die mit ihr redet, meint, alles sei geregelt, sie könne in Ruhe gehen. Wir verabschieden uns, sie bekommt ein starkes Schmerzmittel, das sie in einen Dämmerzustand versetzt. Ich bleibe noch, bis sie einschläft, fahre dann zur Arbeit.
Abends ist sie allein im Zimmer, die Fenster sind weit offen, Abendlicht kommt herein, Luft, sie wartet immer noch.
Ich setze mich ans Bett, halte ihre Hand, bleibe, bis sie gegangen ist.





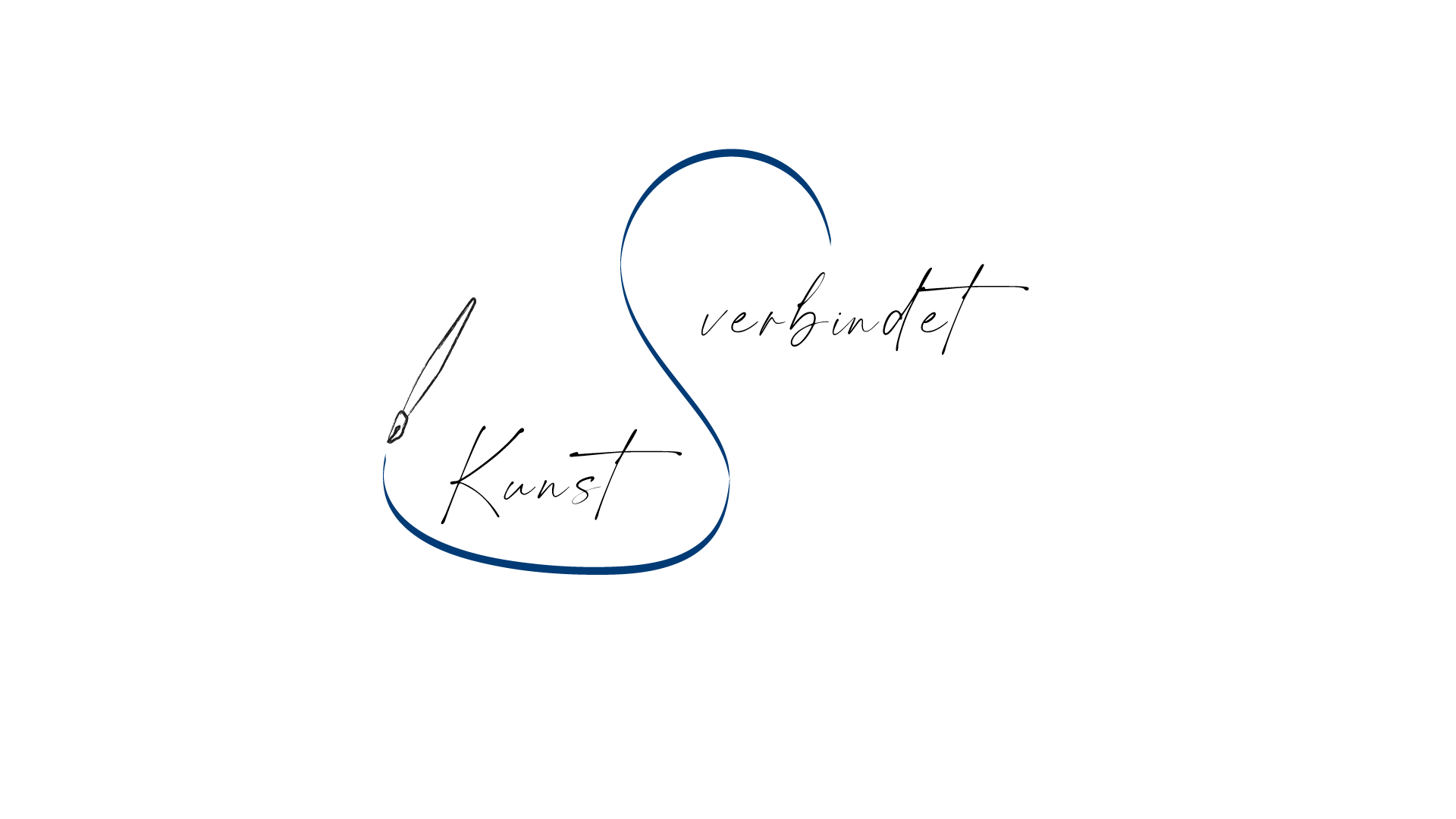
Kommentare